...powered by
freaks-at-work
freaks-at-work
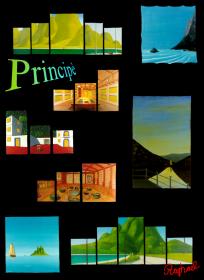
Die Flaute blieb uns treu. Es war frustrierend, keinerlei Kräuselbewegung auf dem Wasser zu sehen. Auf Nachtwache holten wir manchmal das Log ein und warfen es im hohen Bogen achteraus, damit die Leine wenigstens einen Moment lang nicht so deprimierend schlaff herunter hing. Von der Patria kannte ich einen nautischen Zauber, etwas, was Seeleute taten, wenn sie einen Schabernack machen wollten, mal einen Orkan erleben oder so etwas. Dazu musste man am Fockmast kratzen. Ein altes Rezept. Roy kannte das ebenfalls. Die Idee gefiel ihm. Wir sollten nichts unversucht lassen. Schaden könne es bestimmt nicht:
»Okay Rafi! Let’s do it!«
Um der Aktion einen würdigen Rahmen zu geben, wählten wir eine Seite aus der Bibel und füllte sie mit afrikanischem Tabak. Ich wollte etwas dramatisches mit Wolken und Gewitter. Es gab da ein Zitat im Matthäus Evangelium, wo beschrieben wurde, was passiert, wenn der Christus eines Tages zurückkommt: (Mt. 24; 30, 27, 28) Dann werden alle Völker der Erde in Wehgeschrei ausbrechen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels herabkommen sehen. Denn wie der Blitz von Osten her aufflammt und bis zum Westen hin leuchtet, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier!
Die hatten schon drastische Vergleiche, die Prediger der Antike. Mit dem Aas war der Elende gemeint. Die Tüte brannte gleichmäßig. Der Rauch stieg senkrecht empor. Ein gutes Zeichen. Wir bliesen je einen Atemzug in die vier Himmelsrichtungen und kratzten von allen Seiten am Fockmast. Das musste reichen, für einen frischen Wind.
Die Nacht blieb stockdunkel, der Himmel bedeckt. Kein Delfin ließ sich blicken. Das Atmen fiel schwer. Der Schweiß lief in die Augen und tropfte von den Haaren an Deck. Wir fühlten uns auf einmal von der Finsternis bedroht, stiegen mit müden Beinen in die master’s cabin ab, um einen Blick auf die Karte zu werfen. Die Golden Harvest wurde vom Guinea-Strom weiter nach Osten getragen. Durch die Bucht von Benin in die Bucht von Biafra.
Von draußen näherten sich Motorengeräusche. Ich folgte Roy an Deck, um nachzuschauen und notfalls die Positionslichter zu setzen. Er schnappte sich das Fernglas, starrte leise fluchend in die Dunkelheit. Da war nichts zu sehen. Die Geräusche kamen trotzdem näher, wurden lauter. Man konnte die Schiffe sogar riechen. Sie fuhren wie wir ohne Positionslichter durch die Nacht. Wahrscheinlich Piraten! Roy wollte keine Lichter setzen. Das hätte die nur auf uns aufmerksam gemacht. Er wusste nicht, ob wir die anderen wecken sollten. Besser die Ruhe bewahren. Panik vermeiden. Die nigerianischen Piraten waren dafür bekannt, dass sie ihren Opfern bestimmte Körperteile abschnitten. In der Bucht von Biafra wurde immer noch mit Menschen gehandelt, mit Sklaven. Wir standen schweißgebadet an Deck, während die dunklen Schatten der stinkenden Seelenverkäufer bedrohlich langsam an uns vorbeizogen.
»Okay Rafi! Let’s do it!«
Um der Aktion einen würdigen Rahmen zu geben, wählten wir eine Seite aus der Bibel und füllte sie mit afrikanischem Tabak. Ich wollte etwas dramatisches mit Wolken und Gewitter. Es gab da ein Zitat im Matthäus Evangelium, wo beschrieben wurde, was passiert, wenn der Christus eines Tages zurückkommt: (Mt. 24; 30, 27, 28) Dann werden alle Völker der Erde in Wehgeschrei ausbrechen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels herabkommen sehen. Denn wie der Blitz von Osten her aufflammt und bis zum Westen hin leuchtet, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier!
Die hatten schon drastische Vergleiche, die Prediger der Antike. Mit dem Aas war der Elende gemeint. Die Tüte brannte gleichmäßig. Der Rauch stieg senkrecht empor. Ein gutes Zeichen. Wir bliesen je einen Atemzug in die vier Himmelsrichtungen und kratzten von allen Seiten am Fockmast. Das musste reichen, für einen frischen Wind.
Die Nacht blieb stockdunkel, der Himmel bedeckt. Kein Delfin ließ sich blicken. Das Atmen fiel schwer. Der Schweiß lief in die Augen und tropfte von den Haaren an Deck. Wir fühlten uns auf einmal von der Finsternis bedroht, stiegen mit müden Beinen in die master’s cabin ab, um einen Blick auf die Karte zu werfen. Die Golden Harvest wurde vom Guinea-Strom weiter nach Osten getragen. Durch die Bucht von Benin in die Bucht von Biafra.
Von draußen näherten sich Motorengeräusche. Ich folgte Roy an Deck, um nachzuschauen und notfalls die Positionslichter zu setzen. Er schnappte sich das Fernglas, starrte leise fluchend in die Dunkelheit. Da war nichts zu sehen. Die Geräusche kamen trotzdem näher, wurden lauter. Man konnte die Schiffe sogar riechen. Sie fuhren wie wir ohne Positionslichter durch die Nacht. Wahrscheinlich Piraten! Roy wollte keine Lichter setzen. Das hätte die nur auf uns aufmerksam gemacht. Er wusste nicht, ob wir die anderen wecken sollten. Besser die Ruhe bewahren. Panik vermeiden. Die nigerianischen Piraten waren dafür bekannt, dass sie ihren Opfern bestimmte Körperteile abschnitten. In der Bucht von Biafra wurde immer noch mit Menschen gehandelt, mit Sklaven. Wir standen schweißgebadet an Deck, während die dunklen Schatten der stinkenden Seelenverkäufer bedrohlich langsam an uns vorbeizogen.

Auch ohne das historische Wissen aus dem Weltalmanach und dem African-Pilot, war Principe eine außergewöhnliche Insel, mit einer pulsierenden, von Vogelstimmen und Wohlgerüchen durchdrungenen Aura, die alle Sinne gleichzeitig in Anspruch nahm. Über der nördlichen Hochebene flimmerte die Luft in der Nachmittagshitze. Im Süden konnten wir zwischen den Vulkanbergen eine permanente Wolkenbildung beobachten. Hunderte kleiner Nebelgespenster, eben noch aus dem Nichts entstanden, stiegen auf zu den Gipfeln, um sich dort zu erleichtern und das Sonnenlicht zu brechen. Zwischen den grünen Basaltkegeln und den bizarren Schloten der steil aufragenden Phonolithe, bildeten sich prächtige Regenbogen. Der Wind flaute ab. Wir segelten nur noch eine Meile pro Stunde, wollten aber vor Sonnenuntergang die Strandregion nach Kokosnüssen absuchen. Die Maschine wurde gestartet. Ich bediente die Ventile. Roy den Anlasser. Kompression! Es rauchte und spritzte. Kati kam donnernd in Fahrt.
Wir blieben dicht unter Land und folgten mit halber Kraft der Westküste in Richtung Süden, begleitet von krächzenden Papageien, denen es Vergnügen bereitete, uns von oben herab vor die Füße zu scheißen, als wollten sie sagen, bis hierhin und nicht weiter. Kris hatte auf einmal wieder sein terrible feeling of déjà-vu. Als wäre er schon einmal hier gewesen. Irgendwie unheimlich. Mir ging es ähnlich. Soviel ungebrochene wilde Natur war gewöhnungsbedürftig. Es gab nicht ein einziges Hochhaus, keine Straße, keinen Leuchtturm, keine Mole.
Die Insel offenbarte sich uns in ihrer ursprünglichen Pracht. Ein Parabolspiegel am Westhang des »Morro Papagaio«, der wie ein neugieriges Ohr aus dem Urwald herausragte, schien der einzige Hinweis auf Zivilisation zu sein. Ansonsten war rundherum alles grün. Auch das Wasser wurde grünlich, als wir in die Baya de Agulhas einliefen, vorbei an kleinen Buchten und terrassenartigen Stränden, an denen schlanke Einbäume in der Sonne lagen. Durchs Fernglas konnte man zwischen den Palmen auf den höher gelegenen Strandterrassen Holzhütten erkennen und nackte Eingeborene, die unbekümmert mit ihren Hunden spielten, als sei dies ein Vorort vom Paradies.
Wir blieben dicht unter Land und folgten mit halber Kraft der Westküste in Richtung Süden, begleitet von krächzenden Papageien, denen es Vergnügen bereitete, uns von oben herab vor die Füße zu scheißen, als wollten sie sagen, bis hierhin und nicht weiter. Kris hatte auf einmal wieder sein terrible feeling of déjà-vu. Als wäre er schon einmal hier gewesen. Irgendwie unheimlich. Mir ging es ähnlich. Soviel ungebrochene wilde Natur war gewöhnungsbedürftig. Es gab nicht ein einziges Hochhaus, keine Straße, keinen Leuchtturm, keine Mole.
Die Insel offenbarte sich uns in ihrer ursprünglichen Pracht. Ein Parabolspiegel am Westhang des »Morro Papagaio«, der wie ein neugieriges Ohr aus dem Urwald herausragte, schien der einzige Hinweis auf Zivilisation zu sein. Ansonsten war rundherum alles grün. Auch das Wasser wurde grünlich, als wir in die Baya de Agulhas einliefen, vorbei an kleinen Buchten und terrassenartigen Stränden, an denen schlanke Einbäume in der Sonne lagen. Durchs Fernglas konnte man zwischen den Palmen auf den höher gelegenen Strandterrassen Holzhütten erkennen und nackte Eingeborene, die unbekümmert mit ihren Hunden spielten, als sei dies ein Vorort vom Paradies.
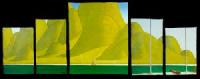
Bis zum Sonnenuntergang blieben uns zwei Stunden Zeit, den Schoner hafenklar zu machen. Die Stagsegel wurden gemeinsam geborgen, danach das fisherman zwischen den Masten. Das Großsegel sollte zum Lüften oben bleiben, solange es windstill blieb. Als nächstes wollten wir das Dingi zu Wasser lassen, um einen kurzen Abstecher an Land zu machen. Momo schwärmte von den Schätzen seiner Heimat, von frischem Obst und Gemüse. Er zeigte auf einmal rüber zum Strand. Von der Westspitze der Kompassbucht kam ein Einbaum mit Außenbordmotor auf uns zugerast.
Das Boot umrundete lärmend die Golden Harvest in einem Abstand von 30 Metern, bis plötzlich stotternd die Maschine verreckte. Bläuliche Abgasnebel waberten durch die Luft. Wir hörten die Flüche des schwarzen Bootsführers und versammelten uns an Steuerbordseite. Der Kerl trug ein zerlumptes, olivgrünes Hemd am Leib, mit riesigen Löchern, die linke Schulter guckte raus. Die Shorts waren total zerfetzt. Er kniete vor seinem Zweitakter, belegte unter wüsten Verwünschungen immer wieder das Startrad, und riss zornig an der Knebelschnur, bis sie in Stücke fiel. Der Rest flog über Bord. Der Mann war mit den Nerven fertig. Er heulte auf, trat um sich und versuchte, den Motor zu würgen.
Elise legte einen Rettungsring bereit, falls der Neger ins Wasser fallen sollte. Das war ein verbitterter Unsympath, mit grobem Nussknackergesicht. Er führte sich auf wie ein Menschenfresser und gab unentwegt Bösartigkeiten von sich, in einer unverständlichen Sprache. Wir blieben trotzdem freundlich und riefen aufmunternd: »High! Hello! How are you?« Er drohte zur Antwort mit der Faust. Momo flüsterte, der Mann sei krank:
»He is suffering from meningitis!«
Es sah ganz danach aus. Uns blieb nichts weiter übrig, als zuzuschauen, bei diesem grotesken Kampf des entnervten Eingeborenen mit der modernen Technik. Dem war es nicht recht, nach der rasanten Anfahrt wieder zum Riemen greifen zu müssen. Er paddelte heulend vor Wut, zeigte zwischendurch zornig auf die Golden Harvest und brüllte:
»Bandéira! Bandéira!«
Wir wussten nicht, was er wollte. Außerdem missfiel uns der Ton und die Art, wie der in seinem Einbaum saß, breitbeinig, mit aus den zerschlissenen Shorts heraushängendem Geschlecht. Das ging nicht nur Elise gegen den Strich, zumal der sich dauernd am Skrotum kratzte. Man mochte nicht hinschauen. Für Roys Empfinden war das »a very hard looking man!« Kris streckte ihm trotzdem die Hände über das Schanzkleid entgegen, als er endlich längsseits lag, doch er weigerte sich, sie zu schütteln. Wir konnten ihm nicht helfen, er wollte nicht an Bord kommen, brüllte nur weiter: »Bandéira!« Zum Schluss stieß er sich fluchend ab und paddelte zurück zum Strand. Wir schauten ratlos hinterher, bis er als dunkler Punkt am Ufer verschwand.
Das Boot umrundete lärmend die Golden Harvest in einem Abstand von 30 Metern, bis plötzlich stotternd die Maschine verreckte. Bläuliche Abgasnebel waberten durch die Luft. Wir hörten die Flüche des schwarzen Bootsführers und versammelten uns an Steuerbordseite. Der Kerl trug ein zerlumptes, olivgrünes Hemd am Leib, mit riesigen Löchern, die linke Schulter guckte raus. Die Shorts waren total zerfetzt. Er kniete vor seinem Zweitakter, belegte unter wüsten Verwünschungen immer wieder das Startrad, und riss zornig an der Knebelschnur, bis sie in Stücke fiel. Der Rest flog über Bord. Der Mann war mit den Nerven fertig. Er heulte auf, trat um sich und versuchte, den Motor zu würgen.
Elise legte einen Rettungsring bereit, falls der Neger ins Wasser fallen sollte. Das war ein verbitterter Unsympath, mit grobem Nussknackergesicht. Er führte sich auf wie ein Menschenfresser und gab unentwegt Bösartigkeiten von sich, in einer unverständlichen Sprache. Wir blieben trotzdem freundlich und riefen aufmunternd: »High! Hello! How are you?« Er drohte zur Antwort mit der Faust. Momo flüsterte, der Mann sei krank:
»He is suffering from meningitis!«
Es sah ganz danach aus. Uns blieb nichts weiter übrig, als zuzuschauen, bei diesem grotesken Kampf des entnervten Eingeborenen mit der modernen Technik. Dem war es nicht recht, nach der rasanten Anfahrt wieder zum Riemen greifen zu müssen. Er paddelte heulend vor Wut, zeigte zwischendurch zornig auf die Golden Harvest und brüllte:
»Bandéira! Bandéira!«
Wir wussten nicht, was er wollte. Außerdem missfiel uns der Ton und die Art, wie der in seinem Einbaum saß, breitbeinig, mit aus den zerschlissenen Shorts heraushängendem Geschlecht. Das ging nicht nur Elise gegen den Strich, zumal der sich dauernd am Skrotum kratzte. Man mochte nicht hinschauen. Für Roys Empfinden war das »a very hard looking man!« Kris streckte ihm trotzdem die Hände über das Schanzkleid entgegen, als er endlich längsseits lag, doch er weigerte sich, sie zu schütteln. Wir konnten ihm nicht helfen, er wollte nicht an Bord kommen, brüllte nur weiter: »Bandéira!« Zum Schluss stieß er sich fluchend ab und paddelte zurück zum Strand. Wir schauten ratlos hinterher, bis er als dunkler Punkt am Ufer verschwand.

Momo und Elise waren damit einverstanden, die Uniformierten erst mal zu ignorieren und in aller Ruhe supper zu machen, um unser Desinteresse zu bekunden. Es gab Katzenfutter mit Bohnen und Reis, wie an einem Feiertag. Wir kochten mit Liebe, deckten den Tisch. Da mochten sie stampfen und brüllen.
Immer mehr Soldaten kamen polternd die Treppe herunter und gingen vor dem Mordillo-Poster in Stellung. Wir kümmerten uns nicht darum. Auch Morishda ließ sich nicht irritieren. Er kniete mitten im Gewühl auf seiner Matte, direkt vor dem Offizier. Die Krieger brüllten und schlugen unrhythmisch mit ihren Gewehrkolben auf den Boden. Mori antwortete mit seiner Trommel. Der Befehlshaber beugte sich schließlich fluchend zu ihm herab. Er holte weit aus. Auf einmal war Ruhe. Morishda packte seine Sachen. Gewalt sei nicht gut:
»Violence no good!«
Unser Widerstand machte die Kämpfer hysterisch. Sie trommelten weiter mit den Gewehren. Der Offizier lief fluchend vor dem Mordillo-Poster auf und ab. Dann blieb er plötzlich stehen, um Hans den Stuhl unterm Arsch wegzutreten. Der Stuhl flog krachend ins Topfregal unter der Spüle.
Hans lag der Länge nach auf dem Boden. Er stöhnte. Es ging los. Sie fielen über uns her. Keiner wurde verschont. Sie wussten, wie man sich Hippies gefügig machte und schnappten Hans. Der blieb einfach liegen, gab weder Tritten noch Schlägen nach, klagte nicht mal, als sie ihn an den Haaren die Treppe hoch zogen, um ihn an Deck zu werfen, wie ein Stück Holz. Als nächstes kam Roy an die Reihe. Kris wurde am Bart gerissen. Ich folgte fluchend. Es war schmerzhaft. Mori hatte wegen seiner Glatze hauptsächlich unter Tritten zu leiden.
Schließlich lagen wir alle an Deck. Die Soldaten traten weiter mit Gebrüll auf uns ein und bearbeiteten mit den Gewehrkolben die Planken. Wir waren direkt in der Hölle gelandet. An den Masten wurden Taschenlampen befestigt, um das Chaos auszuleuchten. Mehrere Einbäume dümpelten längsseits. Hans krümmte sich stöhnend neben dem Niedergang. Ich konnte ihm nicht helfen. Für den Notfall hatten wir so oder so keine Medizin an Bord. Nicht einmal Jod oder Heftpflaster.
Immer mehr Soldaten kamen polternd die Treppe herunter und gingen vor dem Mordillo-Poster in Stellung. Wir kümmerten uns nicht darum. Auch Morishda ließ sich nicht irritieren. Er kniete mitten im Gewühl auf seiner Matte, direkt vor dem Offizier. Die Krieger brüllten und schlugen unrhythmisch mit ihren Gewehrkolben auf den Boden. Mori antwortete mit seiner Trommel. Der Befehlshaber beugte sich schließlich fluchend zu ihm herab. Er holte weit aus. Auf einmal war Ruhe. Morishda packte seine Sachen. Gewalt sei nicht gut:
»Violence no good!«
Unser Widerstand machte die Kämpfer hysterisch. Sie trommelten weiter mit den Gewehren. Der Offizier lief fluchend vor dem Mordillo-Poster auf und ab. Dann blieb er plötzlich stehen, um Hans den Stuhl unterm Arsch wegzutreten. Der Stuhl flog krachend ins Topfregal unter der Spüle.
Hans lag der Länge nach auf dem Boden. Er stöhnte. Es ging los. Sie fielen über uns her. Keiner wurde verschont. Sie wussten, wie man sich Hippies gefügig machte und schnappten Hans. Der blieb einfach liegen, gab weder Tritten noch Schlägen nach, klagte nicht mal, als sie ihn an den Haaren die Treppe hoch zogen, um ihn an Deck zu werfen, wie ein Stück Holz. Als nächstes kam Roy an die Reihe. Kris wurde am Bart gerissen. Ich folgte fluchend. Es war schmerzhaft. Mori hatte wegen seiner Glatze hauptsächlich unter Tritten zu leiden.
Schließlich lagen wir alle an Deck. Die Soldaten traten weiter mit Gebrüll auf uns ein und bearbeiteten mit den Gewehrkolben die Planken. Wir waren direkt in der Hölle gelandet. An den Masten wurden Taschenlampen befestigt, um das Chaos auszuleuchten. Mehrere Einbäume dümpelten längsseits. Hans krümmte sich stöhnend neben dem Niedergang. Ich konnte ihm nicht helfen. Für den Notfall hatten wir so oder so keine Medizin an Bord. Nicht einmal Jod oder Heftpflaster.

Gegen Mittag hörten wir Schraubengeräusche. Hans stoppte den Rekorder. Ich stieg an Deck, um nachzuschauen. Von Norden her kam ein alter Fischkutter auf uns zu, etwa halb so groß wie die Golden Harvest. Vorn an Deck standen Momo, Elise und Roy. Hinter ihnen Soldaten. Hans fühlte sich sofort geheilt. Wir nahmen die Leinen entgegen und machten fest.
Die Crew wirkte ausgebrannt. Total erschöpft. Roy erklärte säuerlich, dass wir nach Santo Antonio fahren müssten. Er wollte Bedingungen stellen, dass die Krieger ihre Waffen auf dem Kutter ließen. Niemand ging darauf ein. Auch nicht auf seine Bedenken, mit einer defekten Maschine ohne Revierkarte an einer Lee-Küste entlang zu segeln. Er hatte bereits mit den Uniformierten geschimpft, doch die verstanden ihn nicht.
Das Voltmeter stand auf Zero. Jenny musste angeworfen werden, um Strom für den Start der Maschine zu bekommen. Der plötzliche Lärm war entsetzlich. Die Soldaten gingen dazwischen. Sie drohten, Jenny zu erschießen. Wir sollten die Hauptmaschine starten, doch ohne Strom funktionierte das nicht. Roy wurde fast irre. Er fluchte:
»Stupid idiots!«
Die Crew redete mit Engelszungen auf die Uniformierten ein. Mit Händen und Füßen. Die Soldaten brüllten und zeigten ihre Kalaschnikows. Von dem Fischerboot kam schließlich ein alter Portugiese auf die Golden Harvest, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Das war wohl der Skipper. Wir standen in der master’s cabin um den großen Kartentisch, unter dem tobenden Generator. Roy lehnte die Verantwortung ab, der Offizier reagierte gereizt. Es ging um die Revierkarte. Ohne Karte wollte Roy nicht losfahren. Er hatte an der Nordspitze der Insel die Klippen gesehen und Stromschnellen voller Strudel. Der Portugiese wusste eine Lösung. Er zeichnete locker aus dem Handgelenk die Küstenlinie der Insel auf ein Blatt Papier und strahlte:
»Bom!«
Roy schüttelte fluchend den Kopf. Das sei keine Karte. Das sei Nonsens. Mit so etwas könne er keine Verantwortung übernehmen:
»I do not take any responsibility!«
Die Atmosphäre war aufgeladen. Jedes Wort führte zu Streit. Die Uniformierten erwarteten, dass alles sofort funktionierte. Nach einem kurzen Wutanfall des Offiziers zwangen sie uns mit vorgehaltenen Waffen, die Maschine zu starten. Es klappte gleich beim ersten Versuch. Kati spuckte Rauch und rosa Wassernebel. Wir lichteten den Anker. Das Großsegel wurde ausgerichtet. Roy stand am Ruder. Halbe Kraft voraus.
Auf dem Fischerboot, das neben uns her fuhr, befanden sich nur noch zwei Personen. Ein Soldat, der das Schiff steuerte, und dieser Blaumann von der FDJ. Professör. Die übrigen Soldaten blieben auf der Golden Harvest. Ebenso der Offizier und der alte Portugiesen mit den vielen Lachfalten im wettergegerbten Gesicht. Der konnte kein Englisch, nahm aber mit einer höflichen Verbeugung unseren Kaffee an. Er sagte ein Zauberwort:
»Obrigado!«
Die Crew wirkte ausgebrannt. Total erschöpft. Roy erklärte säuerlich, dass wir nach Santo Antonio fahren müssten. Er wollte Bedingungen stellen, dass die Krieger ihre Waffen auf dem Kutter ließen. Niemand ging darauf ein. Auch nicht auf seine Bedenken, mit einer defekten Maschine ohne Revierkarte an einer Lee-Küste entlang zu segeln. Er hatte bereits mit den Uniformierten geschimpft, doch die verstanden ihn nicht.
Das Voltmeter stand auf Zero. Jenny musste angeworfen werden, um Strom für den Start der Maschine zu bekommen. Der plötzliche Lärm war entsetzlich. Die Soldaten gingen dazwischen. Sie drohten, Jenny zu erschießen. Wir sollten die Hauptmaschine starten, doch ohne Strom funktionierte das nicht. Roy wurde fast irre. Er fluchte:
»Stupid idiots!«
Die Crew redete mit Engelszungen auf die Uniformierten ein. Mit Händen und Füßen. Die Soldaten brüllten und zeigten ihre Kalaschnikows. Von dem Fischerboot kam schließlich ein alter Portugiese auf die Golden Harvest, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Das war wohl der Skipper. Wir standen in der master’s cabin um den großen Kartentisch, unter dem tobenden Generator. Roy lehnte die Verantwortung ab, der Offizier reagierte gereizt. Es ging um die Revierkarte. Ohne Karte wollte Roy nicht losfahren. Er hatte an der Nordspitze der Insel die Klippen gesehen und Stromschnellen voller Strudel. Der Portugiese wusste eine Lösung. Er zeichnete locker aus dem Handgelenk die Küstenlinie der Insel auf ein Blatt Papier und strahlte:
»Bom!«
Roy schüttelte fluchend den Kopf. Das sei keine Karte. Das sei Nonsens. Mit so etwas könne er keine Verantwortung übernehmen:
»I do not take any responsibility!«
Die Atmosphäre war aufgeladen. Jedes Wort führte zu Streit. Die Uniformierten erwarteten, dass alles sofort funktionierte. Nach einem kurzen Wutanfall des Offiziers zwangen sie uns mit vorgehaltenen Waffen, die Maschine zu starten. Es klappte gleich beim ersten Versuch. Kati spuckte Rauch und rosa Wassernebel. Wir lichteten den Anker. Das Großsegel wurde ausgerichtet. Roy stand am Ruder. Halbe Kraft voraus.
Auf dem Fischerboot, das neben uns her fuhr, befanden sich nur noch zwei Personen. Ein Soldat, der das Schiff steuerte, und dieser Blaumann von der FDJ. Professör. Die übrigen Soldaten blieben auf der Golden Harvest. Ebenso der Offizier und der alte Portugiesen mit den vielen Lachfalten im wettergegerbten Gesicht. Der konnte kein Englisch, nahm aber mit einer höflichen Verbeugung unseren Kaffee an. Er sagte ein Zauberwort:
»Obrigado!«

Kurz nach der Halse wurden sie still. Die Golden Harvest lag ungünstig in den Wellen. Der Schoner gierte und schlingerte. Das Fischerboot neben uns torkelte durch die Fluten. Momo und Elise kochten Kaffee. Die Krieger saßen mit ausgestreckten Beinen und hängenden Köpfen an Deck, die Gewehre gegen die Reling gelehnt. Sie wirkten blass. Keiner sprach. Sie wollten ihre Ruhe haben. Ein friedliches Bild. Der Wind strich sanft durch die Segel. Das Gurgeln des Wassers war zu hören. Das Kartoffeln von Kati Kelvin.
Momo und Elise kamen mit je zwei Muggen Kaffee in jeder Hand an Deck. Eine für Roy, eine für den Portugiesen: »Obrigado! Obrigado!« Sie drängten mit vielen Worten den Soldaten ihr Heißgetränk auf, aber die mochten nicht. Denen war schlecht. Momo konnte es nicht akzeptieren. Das sei ein Geschenk! Er hielt einem der Uniformierten den dampfenden Becher unter die Nase:
»My brother, obrigado!«
Der Soldat verweigerte. Er drehte sich um und kotzte krächzend über das Schanzkleid. Momo reagierte beleidigt. Elise sollte sich das anschauen:
»My sister, look at this stupid idiot!«
Die Schergen sanken immer tiefer in sich zusammen. Sie litten furchtbar auf dieser Fahrt durch die Stromschnellen und Strudel. Der Schoner holte weit über. Einem rutschte die Kalaschnikow von der Reling und krachte scheppernd an Deck. Alle schauten hin. Der Besitzer der Waffe wirkte genervt. Er fing an zu husten, zu rülpsen, zu würgen. Es klang erbärmlich. Er schaffte es gerade noch beizudrehen und den Hals nach Außenbord zu hängen.
Die übrigen Soldaten folgten dem Beispiel. Sie zeigten uns die Achtersteven und opferten unter grässlichen Geräuschen. Es war ein surreales Erlebnis, unter der Peace-Flagge durch diese Urlandschaft zu segeln, mit verbotenen Büchern an Bord, und uniformierten Analphabeten, die rhythmisch über die Reling erbrachen. Der Offizier saß mit hängenden Backen auf dem Süll der Ruderhaustür. Er hielt sich den Kopf. Hans stand neben dem Portugiesen vor der life raft und hörte dem Opa geduldig zu, obwohl er nichts verstehen konnte, außer dem Wort Obrigado.
Die Kalaschnikows lagen derweil an Deck herum, zwischen den leergekotzten Soldaten. Die waren so seekrank, dass sie nichts mehr sehen konnten, nichts mehr sehen wollten. Sie wollten am liebsten tot sein.
Momo und Elise kamen mit je zwei Muggen Kaffee in jeder Hand an Deck. Eine für Roy, eine für den Portugiesen: »Obrigado! Obrigado!« Sie drängten mit vielen Worten den Soldaten ihr Heißgetränk auf, aber die mochten nicht. Denen war schlecht. Momo konnte es nicht akzeptieren. Das sei ein Geschenk! Er hielt einem der Uniformierten den dampfenden Becher unter die Nase:
»My brother, obrigado!«
Der Soldat verweigerte. Er drehte sich um und kotzte krächzend über das Schanzkleid. Momo reagierte beleidigt. Elise sollte sich das anschauen:
»My sister, look at this stupid idiot!«
Die Schergen sanken immer tiefer in sich zusammen. Sie litten furchtbar auf dieser Fahrt durch die Stromschnellen und Strudel. Der Schoner holte weit über. Einem rutschte die Kalaschnikow von der Reling und krachte scheppernd an Deck. Alle schauten hin. Der Besitzer der Waffe wirkte genervt. Er fing an zu husten, zu rülpsen, zu würgen. Es klang erbärmlich. Er schaffte es gerade noch beizudrehen und den Hals nach Außenbord zu hängen.
Die übrigen Soldaten folgten dem Beispiel. Sie zeigten uns die Achtersteven und opferten unter grässlichen Geräuschen. Es war ein surreales Erlebnis, unter der Peace-Flagge durch diese Urlandschaft zu segeln, mit verbotenen Büchern an Bord, und uniformierten Analphabeten, die rhythmisch über die Reling erbrachen. Der Offizier saß mit hängenden Backen auf dem Süll der Ruderhaustür. Er hielt sich den Kopf. Hans stand neben dem Portugiesen vor der life raft und hörte dem Opa geduldig zu, obwohl er nichts verstehen konnte, außer dem Wort Obrigado.
Die Kalaschnikows lagen derweil an Deck herum, zwischen den leergekotzten Soldaten. Die waren so seekrank, dass sie nichts mehr sehen konnten, nichts mehr sehen wollten. Sie wollten am liebsten tot sein.

Kurz vor Santo Antonio wurden wir vom Sonnenuntergang überrascht. Plötzlich war es stockfinster. Es gab keine Seezeichen, keine Betonnung. Die Soldaten standen im Weg. Roy schaltete das Getriebe auf Leerlauf und wartete bis der Schoner still lag. Der Anker fiel. Ich holte das Lot. Zweieinhalb Faden Wassertiefe. Roy wurde fast verrückt. Wie sollte er unter diesen Umständen die Verantwortung übernehmen?
Wir versammelten uns in der master’s cabin. Der Offizier versuchte zu erklären, dass sehr viel größere Handelsschiffe viel weiter rein fahren würden, in die Bucht. Er machte eine Zeichnung. Roy weigerte sich:
»I do not take any responsibility!«
Um die Verständigung zu erleichtern, kramte er aus den Bücherkisten ein kleines portugiesisch-englisches Wörterbuch mit Satzbeispielen für besondere Gelegenheiten: »Wo geht es hier zum Bahnhof«, und so was. Kati kartoffelte derweil im Leerlauf. Momo schob sich zwischen Roy und den Offizier. Er war bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Elise gab ihm recht. Sie redete auf die Soldaten ein, dass sie sich bitte entspannen sollten:
»Relax! Obrigado! Please!« Momo würde das schon regeln.
Der Offizier grunzte unwillig. Er verlangte Bewegung, Gehorsam, schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir hatten ebenfalls genug. Jeder sagte seine Meinung. Die Stiefelknechte wurden nervös. Momo und Elise wollten nicht länger diskutieren. Sie gingen einfach an Deck, lichteten den Anker und gaben halbe Kraft voraus. Kati donnerte los. Roy fluchte. Der Offizier zog den Colt. Es gab Tumult, als das Schiff wenig später mit einem kräftigen Ruck und lautem Knirschen auf Grund lief. Alle brüllten durcheinander. Elise keifte. Die Soldaten trampelten. Sie wussten nicht, wo sie hinschießen sollten. Das Rasseln der Ankerkette war zu hören. Kati wurde abgewürgt.
Roy kochte vor Wut. Er wollte eine Karte sehen. Ohne Revierkarte würde er jede Verantwortung ablehnen. Momo ergriff die Initiative. Er zeigte auf Roy und gab dem Offizier Order, nicht länger mit dem verrückten Menschen zu verhandeln, der sei krank:
»He is a sick person!«
Roys Antwort war ebenfalls treffend. Der Befehlshaber reagierte grantig. Er wollte wissen, wer von uns der Kapitän sei. Elise deutete auf Momo. Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Hans suchte erfolglos zu vermitteln. Roy zeigte Elise einen Vogel und Momo den Finger. Der Offizier fluchte ungehalten. Die Sache drohte zu eskalieren. Momo wurde schließlich ekstatisch. Er nahm ruckartig Haltung an, wies mit ausgestrecktem Arm auf Roy und befahl dem Kommandeur mit bebender Stimme, diesen Mann zu verhaften:
»Arrest this man!«
Der Offizier fasste sich an die Mütze. Er musste husten. Momo stand da, mit ausgestrecktem Arm und geblähten Nüstern, zitternd vor Zorn. Er verzog das Gesicht wie Captain Ahab, schaute ihm tief in die staunenden Augen und wiederholte seinen Befehl:
»I told you to arrest this man!«
Dem Offizier platzte daraufhin der Kragen. Er schlug mit der Faust auf den Kartentisch und fing an, Befehle zu brüllen. Das Licht ging aus. Die Batterien waren erschöpft. Wir wurden brutal an Deck getrieben. Die Soldaten stießen uns die Gewehrläufe in die Nieren. Alle fluchten durcheinander. Ein schrecklicher Lärm. Das Getrampel der Stiefel. Die Stimme von Elise und das Gebrüll der Uniformierten.
Wir versammelten uns in der master’s cabin. Der Offizier versuchte zu erklären, dass sehr viel größere Handelsschiffe viel weiter rein fahren würden, in die Bucht. Er machte eine Zeichnung. Roy weigerte sich:
»I do not take any responsibility!«
Um die Verständigung zu erleichtern, kramte er aus den Bücherkisten ein kleines portugiesisch-englisches Wörterbuch mit Satzbeispielen für besondere Gelegenheiten: »Wo geht es hier zum Bahnhof«, und so was. Kati kartoffelte derweil im Leerlauf. Momo schob sich zwischen Roy und den Offizier. Er war bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Elise gab ihm recht. Sie redete auf die Soldaten ein, dass sie sich bitte entspannen sollten:
»Relax! Obrigado! Please!« Momo würde das schon regeln.
Der Offizier grunzte unwillig. Er verlangte Bewegung, Gehorsam, schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir hatten ebenfalls genug. Jeder sagte seine Meinung. Die Stiefelknechte wurden nervös. Momo und Elise wollten nicht länger diskutieren. Sie gingen einfach an Deck, lichteten den Anker und gaben halbe Kraft voraus. Kati donnerte los. Roy fluchte. Der Offizier zog den Colt. Es gab Tumult, als das Schiff wenig später mit einem kräftigen Ruck und lautem Knirschen auf Grund lief. Alle brüllten durcheinander. Elise keifte. Die Soldaten trampelten. Sie wussten nicht, wo sie hinschießen sollten. Das Rasseln der Ankerkette war zu hören. Kati wurde abgewürgt.
Roy kochte vor Wut. Er wollte eine Karte sehen. Ohne Revierkarte würde er jede Verantwortung ablehnen. Momo ergriff die Initiative. Er zeigte auf Roy und gab dem Offizier Order, nicht länger mit dem verrückten Menschen zu verhandeln, der sei krank:
»He is a sick person!«
Roys Antwort war ebenfalls treffend. Der Befehlshaber reagierte grantig. Er wollte wissen, wer von uns der Kapitän sei. Elise deutete auf Momo. Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Hans suchte erfolglos zu vermitteln. Roy zeigte Elise einen Vogel und Momo den Finger. Der Offizier fluchte ungehalten. Die Sache drohte zu eskalieren. Momo wurde schließlich ekstatisch. Er nahm ruckartig Haltung an, wies mit ausgestrecktem Arm auf Roy und befahl dem Kommandeur mit bebender Stimme, diesen Mann zu verhaften:
»Arrest this man!«
Der Offizier fasste sich an die Mütze. Er musste husten. Momo stand da, mit ausgestrecktem Arm und geblähten Nüstern, zitternd vor Zorn. Er verzog das Gesicht wie Captain Ahab, schaute ihm tief in die staunenden Augen und wiederholte seinen Befehl:
»I told you to arrest this man!«
Dem Offizier platzte daraufhin der Kragen. Er schlug mit der Faust auf den Kartentisch und fing an, Befehle zu brüllen. Das Licht ging aus. Die Batterien waren erschöpft. Wir wurden brutal an Deck getrieben. Die Soldaten stießen uns die Gewehrläufe in die Nieren. Alle fluchten durcheinander. Ein schrecklicher Lärm. Das Getrampel der Stiefel. Die Stimme von Elise und das Gebrüll der Uniformierten.

Die Pier von Santo Antonio war klein und spärlich beleuchtet. Wir mussten eine Leiter hochsteigen. Schließlich stand die gesamte Crew oben versammelt, umringt von Soldaten. Wir bildeten eine Kolonne und folgten dem Weg ins Landesinnere. Es gab nur eine alte Schotterstraße. Links und rechts gingen die Schergen. In der Mitte wir, wie gefangene Piraten, nur ohne Eisenringe und Ketten. Sie fürchteten uns, obwohl wir barfuß und unbewaffnet waren. Die knapp 1000 Meter hohen Basaltkegel der Insel wirkten wie traurige schwarze Riesen vor dem indigoblauen Nachthimmel. Das Geschrei wilder Vögel begleitete uns, und das Getrampel der Stiefel im Kies.
Wir gelangten zu einem Anwesen mit erleuchteten Fenstern und breiter Treppe, die zu einer Art Veranda führte. Das Gebäude aus der Kolonialzeit erinnerte an ein Rathaus. Von der Terrasse ging rechts und links je eine Tür ab. Wir wurden nach rechts beordert, in einen leeren Raum, etwa sieben mal acht Meter. Außer einem brusthohen Paravent mit Durchlass gab es dort nichts. Die großen Fenster waren vergittert. Eine Glühbirne hing lieblos an ihren Drähten von der Decke herab. Viel schäbiger als unsere Verkabelungen auf der Golden Harvest. Das Zimmer musste einmal sehr schön gewesen sein, mit Stuck und hellblauer Bemalung. Es wirkte ziemlich heruntergekommen.
Sie führten uns in den hinteren Teil. Dort kauerten wir auf dem Fußboden, jeder für sich. Nur Momo und Elise saßen zusammen. Roy blätterte im Wörterbuch. Er versuchte eine Aussage, die er machen wollte, ins Portugiesische zu übersetzen. Die Krieger verließen den Raum und verriegelten geräuschvoll die Tür.
Wir gelangten zu einem Anwesen mit erleuchteten Fenstern und breiter Treppe, die zu einer Art Veranda führte. Das Gebäude aus der Kolonialzeit erinnerte an ein Rathaus. Von der Terrasse ging rechts und links je eine Tür ab. Wir wurden nach rechts beordert, in einen leeren Raum, etwa sieben mal acht Meter. Außer einem brusthohen Paravent mit Durchlass gab es dort nichts. Die großen Fenster waren vergittert. Eine Glühbirne hing lieblos an ihren Drähten von der Decke herab. Viel schäbiger als unsere Verkabelungen auf der Golden Harvest. Das Zimmer musste einmal sehr schön gewesen sein, mit Stuck und hellblauer Bemalung. Es wirkte ziemlich heruntergekommen.
Sie führten uns in den hinteren Teil. Dort kauerten wir auf dem Fußboden, jeder für sich. Nur Momo und Elise saßen zusammen. Roy blätterte im Wörterbuch. Er versuchte eine Aussage, die er machen wollte, ins Portugiesische zu übersetzen. Die Krieger verließen den Raum und verriegelten geräuschvoll die Tür.

Auf einmal standen wir im Freien, in einem Hof mit rot blühenden Büschen und Bäumen. Die Sonne strahlte. Wir folgten dem Trampelpfad zu einem weiteren Hof, an den eine Art Gefängnis angrenzte und ein schönes Haus aus der Kolonialzeit. Die beiden Gebäude waren durch eine Mauer verbunden. Dort sollte ich mich hin stellen, mit dem Gesicht zur Wand.
Die Mauer war von Kugeleinschlägen durchlöchert. Ich wartete eine Weile, achtete auf die Geräusche hinter mir, das Knirschen der Stiefel und wie sie mit den Waffen hantierten. Dann machte es auf einmal »Klick«, als hätte jemand abgedrückt. Wahrscheinlich Ladehemmung. Es wunderte mich, dass die einfach abdrückten, ohne Kommando. Im nächsten Moment brüllte jemand. Es klang resolut. Ein Schießbefehl. Ich blieb einfach stehen. Die Order wurde wiederholt. Einer kam von hinten auf mich zu. Ich war hellwach und dachte: Der nimmt jetzt die Pistole, weil das mit dem Gewehr nicht funktioniert. Ich wurde an der Schulter gepackt, umgedreht und mit dem Rücken gegen die Wand gedrückt.
Zehn Meter entfernt lungerten die Soldaten mit ihren Kalaschnikows. Außerdem stand dort ein Stuhl, und auf dem Stuhl die Faltenbalg-Kamera von Professör. Er fuchtelte mit den Armen, zerlegte das Objektiv und baute es wieder zusammen. Irgendetwas klemmte. Die Hinrichtung verzögerte sich. Sie wollten mich vorher noch fotografieren, aber ich hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen. Es war kein Spaß mehr.
Die Kamera machte »Klick«. Ich wurde von allen Seiten gefilmt. Danach führten sie mich zurück ins Gebäude. Mir war schlecht. Das Rauchen auf nüchternen Magen, der ganze Stress. Die Hexen im Mittelalter bekamen immer erst nach der Folter etwas zu essen, weil sie sonst alles vollgekotzt hätten. Ich konnte die Veranda erkennen, den Raum zwischen unserem Gefängnis und dem Verhörtrakt. Sie entriegelten die Tür und schubsten mich ins Zimmer. Da waren die anderen. Elise, Kris, Hans und Roy. Sie saßen vereinzelt auf den Pritschen. Nur Momo fehlte. Morishda lag immer noch stöhnend quer vor der Tür.
Die Mauer war von Kugeleinschlägen durchlöchert. Ich wartete eine Weile, achtete auf die Geräusche hinter mir, das Knirschen der Stiefel und wie sie mit den Waffen hantierten. Dann machte es auf einmal »Klick«, als hätte jemand abgedrückt. Wahrscheinlich Ladehemmung. Es wunderte mich, dass die einfach abdrückten, ohne Kommando. Im nächsten Moment brüllte jemand. Es klang resolut. Ein Schießbefehl. Ich blieb einfach stehen. Die Order wurde wiederholt. Einer kam von hinten auf mich zu. Ich war hellwach und dachte: Der nimmt jetzt die Pistole, weil das mit dem Gewehr nicht funktioniert. Ich wurde an der Schulter gepackt, umgedreht und mit dem Rücken gegen die Wand gedrückt.
Zehn Meter entfernt lungerten die Soldaten mit ihren Kalaschnikows. Außerdem stand dort ein Stuhl, und auf dem Stuhl die Faltenbalg-Kamera von Professör. Er fuchtelte mit den Armen, zerlegte das Objektiv und baute es wieder zusammen. Irgendetwas klemmte. Die Hinrichtung verzögerte sich. Sie wollten mich vorher noch fotografieren, aber ich hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen. Es war kein Spaß mehr.
Die Kamera machte »Klick«. Ich wurde von allen Seiten gefilmt. Danach führten sie mich zurück ins Gebäude. Mir war schlecht. Das Rauchen auf nüchternen Magen, der ganze Stress. Die Hexen im Mittelalter bekamen immer erst nach der Folter etwas zu essen, weil sie sonst alles vollgekotzt hätten. Ich konnte die Veranda erkennen, den Raum zwischen unserem Gefängnis und dem Verhörtrakt. Sie entriegelten die Tür und schubsten mich ins Zimmer. Da waren die anderen. Elise, Kris, Hans und Roy. Sie saßen vereinzelt auf den Pritschen. Nur Momo fehlte. Morishda lag immer noch stöhnend quer vor der Tür.

Ein Teil der Offiziere und die meisten Soldaten begleiteten uns zur Golden Harvest, die immer noch auf der Sandbank festlag. Sie kamen mit an Bord. Wir öffneten die Luken und Niedergänge, sahen das Chaos: Überall lagen Berge von Büchern, aufgeklappt, durcheinander, mit zerknickten Seiten und abgerissenen Deckeln, dazwischen der Inhalt der Kammern, Kojen und Regale ausgebreitet auf den Bohlen. Die Bilgen waren übergelaufen.
Zwischen den Müllbergen standen Molotow-Cocktails, als ob sie den Schoner in die Luft jagen wollten. Wir konnten uns das nicht erklären. Die Zünder hatten schon mal gebrannt, die Tücher in den Flaschenhälsen waren verkohlt. Es roch nach Kerosin. Vielleicht wurden die Dinger als Lichtquelle benutzt? Für uns war es ein Akt der Gewalt. Sie steckten überall. Im Maschinenraum, in der master’s cabin, auf dem Tisch in der Kombüse, vorn im Kabelgatt. Höchst gefährlich!
Elise rastete aus beim Anblick dieser Schweinerei. Sie verfluchte die Soldaten und drohte mit der Faust. Roy bekam einen Wutanfall, als sie ihn zwingen wollten Kati zu starten. Das ging noch nicht, sie sollten das endlich kapieren: »For the sake of a bloody fuck!«
Kris aktivierte den Generator. Ein entsetzlicher Lärm. Ich wurde von einem der Leute geschubst und fing an zu fluchen. Das Fischerboot drückte uns von der Sandbank, obwohl die Maschine noch gar nicht lief. Wir zeigten den Offizieren wütend den Finger. Sie brüllten Befehle. Die Schergen entsicherten ihre Gewehre und schossen in die Luft.
Im Maschinenraum schwammen zerfledderte Bücher in der Bilge. Die Antriebswelle lag unter Wasser. Roy stand bis zu den Knöcheln in der öligen Brühe, bei dem Versuch, die Maschine zu starten. Ich bediente die Ventile. Kati spuckte Rostnebel. Danach sprang sie fauchend an. Unser Trinkwassertank war leer. Wir hatten nur noch einen Reservekanister und keine frischen Lebensmittel. Roy lehnte die Verantwortung ab. Unter solchen Umständen könne er keine Verantwortung tragen. Ich versuchte, ihm Mut zu machen. Dem Befehlshaber dauerte das zu lange. Er brüllte furchtbar, mit hochrotem Kopf. Wir sollten Gas geben und losfahren. Okay! Roy kümmerte sich um das Getriebe. Halbe Kraft voraus. Die Stagsegel wurden gehisst, das Großsegel ausgerichtet. Es gab viel zu tun. Alles, was lose an Deck herumlag, musste festgelascht werden, um das Schiff halbwegs seeklar zu kriegen. Die Stiefelknechte blieben dauernd in unserer Nähe.
Bis zum Sonnenuntergang hatten wir die Bucht von Santo Antonio hinter uns. Das Fischerboot kam längsseits, um die Soldaten von Bord zu holen. Wir fluchten wüst hinterher und drohten mit den Fäusten, bis Schüsse fielen. Erst schossen sie in die Luft, dann gezielt. Wir ließen uns flach auf das Deck fallen, hörten die Kugeln über den Köpfen pfeifen. Danach herrschte wieder Ruhe.
Das Boot eskortierte uns aus der Dreimeilenzone. Sie schossen noch einmal und drehten dann ab, bis nur noch ein Lichtpunkt in der Dunkelheit zu sehen war. Die hatten lediglich ein Rundum-Licht im Masttopp, keine Positionslampen, sodass wir nicht erkennen konnten, in welche Richtung der Kutter fuhr, ob sie auch wirklich zurückblieben. Wir sahen das Licht noch sehr lange. Es wirkte wie ein Glühwürmchen vor der monumentalen Kulisse dieser verfluchten Insel.
Zwischen den Müllbergen standen Molotow-Cocktails, als ob sie den Schoner in die Luft jagen wollten. Wir konnten uns das nicht erklären. Die Zünder hatten schon mal gebrannt, die Tücher in den Flaschenhälsen waren verkohlt. Es roch nach Kerosin. Vielleicht wurden die Dinger als Lichtquelle benutzt? Für uns war es ein Akt der Gewalt. Sie steckten überall. Im Maschinenraum, in der master’s cabin, auf dem Tisch in der Kombüse, vorn im Kabelgatt. Höchst gefährlich!
Elise rastete aus beim Anblick dieser Schweinerei. Sie verfluchte die Soldaten und drohte mit der Faust. Roy bekam einen Wutanfall, als sie ihn zwingen wollten Kati zu starten. Das ging noch nicht, sie sollten das endlich kapieren: »For the sake of a bloody fuck!«
Kris aktivierte den Generator. Ein entsetzlicher Lärm. Ich wurde von einem der Leute geschubst und fing an zu fluchen. Das Fischerboot drückte uns von der Sandbank, obwohl die Maschine noch gar nicht lief. Wir zeigten den Offizieren wütend den Finger. Sie brüllten Befehle. Die Schergen entsicherten ihre Gewehre und schossen in die Luft.
Im Maschinenraum schwammen zerfledderte Bücher in der Bilge. Die Antriebswelle lag unter Wasser. Roy stand bis zu den Knöcheln in der öligen Brühe, bei dem Versuch, die Maschine zu starten. Ich bediente die Ventile. Kati spuckte Rostnebel. Danach sprang sie fauchend an. Unser Trinkwassertank war leer. Wir hatten nur noch einen Reservekanister und keine frischen Lebensmittel. Roy lehnte die Verantwortung ab. Unter solchen Umständen könne er keine Verantwortung tragen. Ich versuchte, ihm Mut zu machen. Dem Befehlshaber dauerte das zu lange. Er brüllte furchtbar, mit hochrotem Kopf. Wir sollten Gas geben und losfahren. Okay! Roy kümmerte sich um das Getriebe. Halbe Kraft voraus. Die Stagsegel wurden gehisst, das Großsegel ausgerichtet. Es gab viel zu tun. Alles, was lose an Deck herumlag, musste festgelascht werden, um das Schiff halbwegs seeklar zu kriegen. Die Stiefelknechte blieben dauernd in unserer Nähe.
Bis zum Sonnenuntergang hatten wir die Bucht von Santo Antonio hinter uns. Das Fischerboot kam längsseits, um die Soldaten von Bord zu holen. Wir fluchten wüst hinterher und drohten mit den Fäusten, bis Schüsse fielen. Erst schossen sie in die Luft, dann gezielt. Wir ließen uns flach auf das Deck fallen, hörten die Kugeln über den Köpfen pfeifen. Danach herrschte wieder Ruhe.
Das Boot eskortierte uns aus der Dreimeilenzone. Sie schossen noch einmal und drehten dann ab, bis nur noch ein Lichtpunkt in der Dunkelheit zu sehen war. Die hatten lediglich ein Rundum-Licht im Masttopp, keine Positionslampen, sodass wir nicht erkennen konnten, in welche Richtung der Kutter fuhr, ob sie auch wirklich zurückblieben. Wir sahen das Licht noch sehr lange. Es wirkte wie ein Glühwürmchen vor der monumentalen Kulisse dieser verfluchten Insel.