...powered by
freaks-at-work
freaks-at-work

Der Hafen von Lomé war einfach an den Strand gebaut. Linker Hand eine Mole mit Kaimauer, rechter Hand die Stückgutpier. Wellenbrecher aus Felsbrocken schützten die Frachter vor der Atlantikdünung. Am Fuß der Mole dümpelten Trawler und ein Kanonenboot der Küstenwache. Das Blau des Himmels spiegelte sich im Wasser. In der Mitte lag, wie ein schwarzer Edelstein, die Golden Harvest vor Anker.
Wir standen neben dieser Küstenstraße unter struppigen Palmen am Strand. Kris hatte Falten auf der Stirn. Das Schiff lag ihm zu tief im Wasser. An der Backbordflanke fehlte die Aufschrift: »Operation Namibia«.
Es roch nach gegrilltem Fisch. Im Osten gab es eine Siedlung. Wellblech- und Palmwedelhütten direkt am Wasser. Überall brannten Lagerfeuer zwischen Bergen blauer Netze und großen Lachen silbrig schimmernder Minifische, die an der Luft getrocknet wurden. Barry wollte die Fischerleute bitten, uns überzusetzen, aber sein Französisch war schlecht. Er fasste sich an den Kopf, ruderte mit den Armen, machte Paddelbewegungen und zeigte zur Golden Harvest. Die Männer standen um ihn herum, die Arme vor der Brust verschränkt.
Auch Kris versuchte sein Glück mit Händen und Füßen, mit all seinem Charme, doch die Leute schüttelten nur die Köpfe. Sie wussten, was wir wollten. Einer der Männer machte das internationale Zeichen für Geld. In meiner Hosentasche steckten noch Kobo-Stücke aus Nigeria. Die wollten sie nicht. Kris legte ein paar andere Münzen dazu. Die Männer prüften das Geld sehr aufmerksam, konnten keinen Wert darin erkennen. Sie interessierten sich für die Vielfalt. Barry hatte irische Coins. Die bunte Mischung wurde in den Händen gewogen.
Ein alter Fischer ohne Zähne war schließlich bereit, uns rüber zu fahren. Wir sollten ihm folgen. Sein Einbaum lag abseits. Das Boot sah fertig aus. Da fehlte eine ganze Ecke Holz am Bug. Wir gaben ihm das Geld und brachten die Piroge ins Wasser. Barry wollte gleich einsteigen, während das Boot noch auf Grund lag. Der Fischermann wurde böse. Der Einbaum musste erst schwimmen, bevor sich da jemand rein setzte. Barry zog sich die Schuhe aus.
Wir saßen hintereinander. Der Fischer stieg als Letzter zu. Es schaukelte bedenklich. Durch das Leck am Bug kam Wasser ins Boot. Barry hielt fluchend die Stiefel hoch. Der Fischer paddelte gegen einen frischen Wind aus Südwest. Kleine beißende Wellen sprangen über die Bordwand. Dem Fährmann gefiel das nicht. Wir sollten lenzen, mit den Händen. Er musste sich beeilen, wenn wir den Schoner noch oberhalb der Wasserlinie erreichen wollten, und verprügelte mit dem Paddel das Meer. Barry wurde gebadet. Seine irischen Flüche konnte keiner verstehen.
Wir standen neben dieser Küstenstraße unter struppigen Palmen am Strand. Kris hatte Falten auf der Stirn. Das Schiff lag ihm zu tief im Wasser. An der Backbordflanke fehlte die Aufschrift: »Operation Namibia«.
Es roch nach gegrilltem Fisch. Im Osten gab es eine Siedlung. Wellblech- und Palmwedelhütten direkt am Wasser. Überall brannten Lagerfeuer zwischen Bergen blauer Netze und großen Lachen silbrig schimmernder Minifische, die an der Luft getrocknet wurden. Barry wollte die Fischerleute bitten, uns überzusetzen, aber sein Französisch war schlecht. Er fasste sich an den Kopf, ruderte mit den Armen, machte Paddelbewegungen und zeigte zur Golden Harvest. Die Männer standen um ihn herum, die Arme vor der Brust verschränkt.
Auch Kris versuchte sein Glück mit Händen und Füßen, mit all seinem Charme, doch die Leute schüttelten nur die Köpfe. Sie wussten, was wir wollten. Einer der Männer machte das internationale Zeichen für Geld. In meiner Hosentasche steckten noch Kobo-Stücke aus Nigeria. Die wollten sie nicht. Kris legte ein paar andere Münzen dazu. Die Männer prüften das Geld sehr aufmerksam, konnten keinen Wert darin erkennen. Sie interessierten sich für die Vielfalt. Barry hatte irische Coins. Die bunte Mischung wurde in den Händen gewogen.
Ein alter Fischer ohne Zähne war schließlich bereit, uns rüber zu fahren. Wir sollten ihm folgen. Sein Einbaum lag abseits. Das Boot sah fertig aus. Da fehlte eine ganze Ecke Holz am Bug. Wir gaben ihm das Geld und brachten die Piroge ins Wasser. Barry wollte gleich einsteigen, während das Boot noch auf Grund lag. Der Fischermann wurde böse. Der Einbaum musste erst schwimmen, bevor sich da jemand rein setzte. Barry zog sich die Schuhe aus.
Wir saßen hintereinander. Der Fischer stieg als Letzter zu. Es schaukelte bedenklich. Durch das Leck am Bug kam Wasser ins Boot. Barry hielt fluchend die Stiefel hoch. Der Fischer paddelte gegen einen frischen Wind aus Südwest. Kleine beißende Wellen sprangen über die Bordwand. Dem Fährmann gefiel das nicht. Wir sollten lenzen, mit den Händen. Er musste sich beeilen, wenn wir den Schoner noch oberhalb der Wasserlinie erreichen wollten, und verprügelte mit dem Paddel das Meer. Barry wurde gebadet. Seine irischen Flüche konnte keiner verstehen.
Der Togolese ging achtern längsseits unter den Autoreifen, die als Fender über die Reling hingen. Zuerst kletterte Kris an Bord. Wir reichten ihm das Gepäck und folgten. Der Fischer verzog sich mit grimmiger Miene.
Nun standen wir im Schatten des Ruderhauses, genau an der Stelle, die ich in Lagos geschrubbt hatte, um Hans zu beeindrucken. Man konnte das immer noch erkennen. Es schien mir wie ein Zeichen, ausgerechnet hier an Bord zu kommen, zurück nach Hause, back home.
Ich schaute nach vorn. Es gab keine Ordnung. Die Stagsegel flatterten lose im Wind. Einzig der Großbaum lag sicher in der Mulde auf dem Dach des Ruderhauses. Das Großsegel hatte allem Anschein nach seine letzte Reise getan. Es hing in den Dirken wie ein erschöpftes Gespenst. An Deck lagen allerhand Spieren herum, Maststengen, Rahen, Bambushölzer, dazwischen große Gasflaschen. Ein wunderschönes Chaos. Da war auch wieder dieser besondere Segelschiffgeruch. Die Lichtreflexe auf dem Wasser rundum wirkten hypnotisierend. Die Bilder brannten sich mir ins Herz. Kris rief nach den anderen:
»Hello there!«
»Anybody home?«
Anscheinend war niemand an Bord. Nur das Huhn tauchte plötzlich an Deck auf; dieses kleine, hellbraun getüpfelte Gickel, mit dem intelligenten Gesicht, das mich in Lagos so erschreckt hatte. Es kam stolz auf uns zu gelaufen und wurde von Kris freudig begrüßt:
»No Nonsense, my dear!«
Er streichelte das Federvieh, fragte besorgt, wie es ihm ginge und was mit den anderen sei. Danach rief er noch mal:
»Anybody home?«
»Elise, Momo?«
»Roy, Hans?«
»Morishda?«
Keine Antwort. Barry blickte nachdenklich rüber zum Strand. Er fürchtete, dass alle im Gefängnis saßen. Kris liebkoste weiter das Huhn. Niemand wollte den Platz verlassen, auf dem wir standen. Grey One, die Katze, erschien verschlafen an Deck, verbrannte sich die Pfoten auf dem heißen Holz und sprang jaulend zurück in den Schatten.
Von unten hörten wir Stimmen. Im Halbdunkel des Niedergangs sah ich Elise. Sie guckte erst ungläubig und strich die Haare aus dem Gesicht. Dann kam sie mit einem Freudenschrei auf uns zu gerannt. Barfuß über die heißen Planken. Sie konnte kaum fassen, dass wir lebendig vor ihr standen. Damit hatte sie nicht mehr gerechnet. Wir drückten und umarmten uns. Beim Erzählen wanderte ihr Blick immer wieder ängstlich zu dem Kanonenboot am Ufer. Dann erschien Reverend Morishita an Deck, mit großen Augen. Er verneigte sich vor jedem Einzelnen:
»Raphael-san!«
»Kris-san!«
»Barry-san!«
»Hohh!«
Mori standen vor Rührung Tränen in den Augen. Er schaute glücklich zum Himmel auf, die Hände vor der Brust gefaltet. Seine Gebete hatten etwas bewirkt. Er schüttelte staunend den Kopf:
»Operation Namibia very strong people!«
»Military no chance!«
Nun standen wir im Schatten des Ruderhauses, genau an der Stelle, die ich in Lagos geschrubbt hatte, um Hans zu beeindrucken. Man konnte das immer noch erkennen. Es schien mir wie ein Zeichen, ausgerechnet hier an Bord zu kommen, zurück nach Hause, back home.
Ich schaute nach vorn. Es gab keine Ordnung. Die Stagsegel flatterten lose im Wind. Einzig der Großbaum lag sicher in der Mulde auf dem Dach des Ruderhauses. Das Großsegel hatte allem Anschein nach seine letzte Reise getan. Es hing in den Dirken wie ein erschöpftes Gespenst. An Deck lagen allerhand Spieren herum, Maststengen, Rahen, Bambushölzer, dazwischen große Gasflaschen. Ein wunderschönes Chaos. Da war auch wieder dieser besondere Segelschiffgeruch. Die Lichtreflexe auf dem Wasser rundum wirkten hypnotisierend. Die Bilder brannten sich mir ins Herz. Kris rief nach den anderen:
»Hello there!«
»Anybody home?«
Anscheinend war niemand an Bord. Nur das Huhn tauchte plötzlich an Deck auf; dieses kleine, hellbraun getüpfelte Gickel, mit dem intelligenten Gesicht, das mich in Lagos so erschreckt hatte. Es kam stolz auf uns zu gelaufen und wurde von Kris freudig begrüßt:
»No Nonsense, my dear!«
Er streichelte das Federvieh, fragte besorgt, wie es ihm ginge und was mit den anderen sei. Danach rief er noch mal:
»Anybody home?«
»Elise, Momo?«
»Roy, Hans?«
»Morishda?«
Keine Antwort. Barry blickte nachdenklich rüber zum Strand. Er fürchtete, dass alle im Gefängnis saßen. Kris liebkoste weiter das Huhn. Niemand wollte den Platz verlassen, auf dem wir standen. Grey One, die Katze, erschien verschlafen an Deck, verbrannte sich die Pfoten auf dem heißen Holz und sprang jaulend zurück in den Schatten.
Von unten hörten wir Stimmen. Im Halbdunkel des Niedergangs sah ich Elise. Sie guckte erst ungläubig und strich die Haare aus dem Gesicht. Dann kam sie mit einem Freudenschrei auf uns zu gerannt. Barfuß über die heißen Planken. Sie konnte kaum fassen, dass wir lebendig vor ihr standen. Damit hatte sie nicht mehr gerechnet. Wir drückten und umarmten uns. Beim Erzählen wanderte ihr Blick immer wieder ängstlich zu dem Kanonenboot am Ufer. Dann erschien Reverend Morishita an Deck, mit großen Augen. Er verneigte sich vor jedem Einzelnen:
»Raphael-san!«
»Kris-san!«
»Barry-san!«
»Hohh!«
Mori standen vor Rührung Tränen in den Augen. Er schaute glücklich zum Himmel auf, die Hände vor der Brust gefaltet. Seine Gebete hatten etwas bewirkt. Er schüttelte staunend den Kopf:
»Operation Namibia very strong people!«
»Military no chance!«

Ich war trotzdem aufgeregt, als er die Trips verteilte. Für jeden ein Stückchen Löschpapier. Das sollten wir eine Viertelstunde im Mund aufbewahren, richtig aussaugen und kauen. Danach den Rest einfach runter schlucken. Es schmeckte neutral, nicht unangenehm. Ich dachte, dass es gleich »Plopp!« macht, doch es passierte nichts. Jedenfalls nicht sofort. Wir wurden mit der Zeit ruhiger und kreativ. Am Fockmast hingen verschiedene Bändsel und Taue, die mein Interesse weckten. Ich versuchte einen Schraubplating zu flechten, richtig mit Freude, und hatte das Gefühl, gerne mit Menschen zusammen zu sein, etwas zu unternehmen. Den anderen ging es ähnlich. Wir strahlten uns an, lachten ohne Grund. Es war das erste Mal, dass wir in Togo so gute Laune hatten.
Irgendjemand kam schließlich auf die Idee, eine Ruderpartie durch den Hafen zu machen. Der Vorschlag wurde angenommen. Nur Morishda blieb an Bord. Wir ruderten glücklich ins Abendrot. Elise summte leise vor sich hin. Das Dingi war hoffnungslos überladen. Das Wasser reichte fast zu den Dollbords. Es machte uns keine Angst. Wir blinzelten einander zu, kommunizierten wortlos, fühlten Übereinstimmung auf einer höheren Ebene und grenzenlose Dankbarkeit für alles Geschaffene. Die Sonne versank goldrot hinter den Lagerhäusern. Die Zeit hörte auf zu existieren. Es gab nur noch Liebe. Frieden und Liebe:
»Peace and love.«
Unsere Reise durch die Nacht führte zu dem einzigen Wrack, das im Hafen lag. Bugspitze und Maststengen ragten aus dem Wasser. Gestrandete Schiffe faszinierten mich. Ein paar Tage zuvor war ich schon einmal dort gewesen. Nun wirkte alles viel schöner, die Farben intensiver, die Konturen schärfer. Das Holz des Havaristen glitzerte und blinkte, als wäre es mit Diamantstaub belegt.
Wir ruderten weiter nach »Rusty Island«, mehrere miteinander verbundene Pontons, die wie eine rostige Insel im Hafen verankert lagen, etwa eine Kabellänge von der Golden Harvest entfernt. Dort gingen wir glückselig längsseits. Es war angenehm, auf diesen von der Sonne erwärmten Tragschiffen barfuß zu laufen, in der lauen Luft.
Elise schlug vor, ein campfire zu machen, mit dem trockenen Pallholz, das überall herumlag. Das Zusammentragen bereitete Vergnügen. Dann saßen wir um die brennenden Scheite mit dem Gefühl, einander zu mögen, wussten auf einmal, was wir so lange Zeit gesucht hatten: Liebe! Ich liebte die ganze Welt und fühlte mich sehr leicht, auch wenn das mit dem Fliegen nicht funktionierte. Es gab keinen Horror, keine Verwirrung. Ich starrte in die Flammen, wartete auf Halluzinationen, Totenköpfe und Gesichte. Nichts erschien, nicht mal ein lumpiger Geist.
Irgendjemand kam schließlich auf die Idee, eine Ruderpartie durch den Hafen zu machen. Der Vorschlag wurde angenommen. Nur Morishda blieb an Bord. Wir ruderten glücklich ins Abendrot. Elise summte leise vor sich hin. Das Dingi war hoffnungslos überladen. Das Wasser reichte fast zu den Dollbords. Es machte uns keine Angst. Wir blinzelten einander zu, kommunizierten wortlos, fühlten Übereinstimmung auf einer höheren Ebene und grenzenlose Dankbarkeit für alles Geschaffene. Die Sonne versank goldrot hinter den Lagerhäusern. Die Zeit hörte auf zu existieren. Es gab nur noch Liebe. Frieden und Liebe:
»Peace and love.«
Unsere Reise durch die Nacht führte zu dem einzigen Wrack, das im Hafen lag. Bugspitze und Maststengen ragten aus dem Wasser. Gestrandete Schiffe faszinierten mich. Ein paar Tage zuvor war ich schon einmal dort gewesen. Nun wirkte alles viel schöner, die Farben intensiver, die Konturen schärfer. Das Holz des Havaristen glitzerte und blinkte, als wäre es mit Diamantstaub belegt.
Wir ruderten weiter nach »Rusty Island«, mehrere miteinander verbundene Pontons, die wie eine rostige Insel im Hafen verankert lagen, etwa eine Kabellänge von der Golden Harvest entfernt. Dort gingen wir glückselig längsseits. Es war angenehm, auf diesen von der Sonne erwärmten Tragschiffen barfuß zu laufen, in der lauen Luft.
Elise schlug vor, ein campfire zu machen, mit dem trockenen Pallholz, das überall herumlag. Das Zusammentragen bereitete Vergnügen. Dann saßen wir um die brennenden Scheite mit dem Gefühl, einander zu mögen, wussten auf einmal, was wir so lange Zeit gesucht hatten: Liebe! Ich liebte die ganze Welt und fühlte mich sehr leicht, auch wenn das mit dem Fliegen nicht funktionierte. Es gab keinen Horror, keine Verwirrung. Ich starrte in die Flammen, wartete auf Halluzinationen, Totenköpfe und Gesichte. Nichts erschien, nicht mal ein lumpiger Geist.

Das Gemeinschaftsleben fand abends statt, im Licht der Ankerlaterne an Deck, oder bei Kerzenschein in der Kombüse. Der Brief an die SWAPO kam nicht voran. Es sollte eine Selbstdarstellung werden. Wir wollten ein Bild von uns vermitteln. Dadurch wurden wir auf uns selbst zurückgeworfen. Es gab kein geschlossenes Bild der Golden Harvest Crew. Seit Lagos war alles anders. Es gab keine Ordnung mehr. Roy konnte das »cooking-chaos« nicht länger ertragen. Früher sei regelmäßig gekocht worden. Momo bezweifelte die Relevanz von Operation Namibia. Das sei ein falscher Weg. Er war ein begnadeter Redner, sprach mit Händen und Füßen und rührte zwischendurch Kakao, damit wir nicht schlapp machten. Auch die Kakerlaken hörten zu. Wir konnten sehen, wie sie um den Kerzenschein, an der Schattengrenze, ihre Fühler bewegten. Wenn jemand das elektrische Licht anmachte - husch! - dann waren sie alle weg.
Nach Mitternacht, wenn die anderen schon in der Koje lagen, blätterte ich manchmal im Fotoalbum der Golden Harvest. Kris hatte die vergangenen zwei Jahre Operation Namibia dürftig mit Bildern dokumentiert. Ich träumte mich hinein in diese Zeit, und entdeckte auf den Fotos Sachen, die sich auch jetzt noch an Bord befanden. Da gab es einen bunten button, so einen Sticker, den man sich anstecken konnte. Über einer Abbildung verschiedener Lebensmittel stand »Food is for sharing!« Auf einem der Fotos hatte Jude diesen Button an der Brust. Deshalb fiel mir das Blechding auf. Ich wusste bloß nicht, was sharing heißen sollte
Der Langenscheidt steckte irgendwo in der master’s cabin. Hans erklärte mir auf Englisch, dass das teilen hieß. Auf diesem Button stand also geschrieben: »Essen ist zum Teilen da!« - Toll! Das wusste ich schon als Kind, aber da hielten sie mich für spinnert. Jetzt stand es auf einem Button. Dieser Knopf hing an einem Kerzenhalter, der auf dem Tisch stand. Da lagen immer viele Sachen herum, auch Bücher und Briefe, und in der Nacht die Kakerlaken.
Nach Mitternacht, wenn die anderen schon in der Koje lagen, blätterte ich manchmal im Fotoalbum der Golden Harvest. Kris hatte die vergangenen zwei Jahre Operation Namibia dürftig mit Bildern dokumentiert. Ich träumte mich hinein in diese Zeit, und entdeckte auf den Fotos Sachen, die sich auch jetzt noch an Bord befanden. Da gab es einen bunten button, so einen Sticker, den man sich anstecken konnte. Über einer Abbildung verschiedener Lebensmittel stand »Food is for sharing!« Auf einem der Fotos hatte Jude diesen Button an der Brust. Deshalb fiel mir das Blechding auf. Ich wusste bloß nicht, was sharing heißen sollte
Der Langenscheidt steckte irgendwo in der master’s cabin. Hans erklärte mir auf Englisch, dass das teilen hieß. Auf diesem Button stand also geschrieben: »Essen ist zum Teilen da!« - Toll! Das wusste ich schon als Kind, aber da hielten sie mich für spinnert. Jetzt stand es auf einem Button. Dieser Knopf hing an einem Kerzenhalter, der auf dem Tisch stand. Da lagen immer viele Sachen herum, auch Bücher und Briefe, und in der Nacht die Kakerlaken.
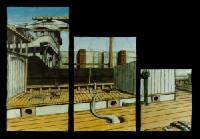
Wir versammelten uns an Deck, holten das Sonnensegel ein und sprachen kurz die Manöver durch. Roy fuhr langsam auf den Anker zu. Elise saß im Bug und gab Zeichen, bis die Kette senkrecht lag. Momo half mir an der Winde. Hans stand mittschiffs. Alles wurde kommentiert. Die Kette war voller Schlick. Es fehlte ein Druckwasserschlauch zum Reinigen. Der Schlamm pladderte ins Kabelgatt. Egal.
Als jüngstes Crewmitglied hatte ich die Ehre, die Golden Harvest rüber zu fahren. Beim Anlegen sollte ich auf den Bugspriet achten. Roy erklärte mir kurz das Getriebe. Das ließ sich über selbst verlegte Seilzüge vom Ruderhaus mit einem Handrad umsteuern. Einen Maschinentelegrafen gab es nicht, keinen Indikator. Man konnte nicht erkennen, ob der Vorwärtsgang, der Rückwärtsgang oder Leerlauf eingestellt war. Roy meinte: »No problem!« Man könne das erfühlen.
Der Gashebel bestand aus einem Drahtseil, mit dem die Dieselzufuhr geregelt wurde. Das Ende hing neben dem Ruderrad an einem krummen Nagel. Ich testete erst mal den Wendekreis. Halbe Kraft voraus. Die Golden Harvest lag wundervoll in der Hand. Das Schiff reagierte auf die kleinste Bewegung des Ruderrades. Roy war stolz auf seine Lady.
Ich steuerte im weiten Bogen die Massengutpier an und drückte den Schoner mit dem Heck zuerst in die Fender des spanischen Fischerbootes. Wir warfen Achter- und Vorderspring, legten die Querleinen und machten fest. Roy stoppte Kati. Mein erstes Anlegemanöver hatte perfekt geklappt. Die Leute auf dem Trawler kannten mich noch. Cosinero winkte begeistert. Ich sollte ihm in die Kombüse folgen und helfen, einen großen Topf aus den Schlingerleisten zu heben. Das sei für die Freunde. »Para amigos!«
Die Suppe war noch warm. Dazu gab es ein paar Flaschen Rotwein. Die wurden gleich in den Kühltrog an Deck verbannt. Neben dem Ruderhaus am Backbord-Schanzkleid lehnte eine große unglasierte Amphore, gefüllt mit Süßwasser, das durch den porösen Ton sickerte und an der Außenseite Verdunstungskälte erzeugte. Ein afrikanischer Kühlschrank aus the Gambia. An der Pier stand ein togolesischer Mitarbeiter der Hafenmeisterei neben dem Hydranten. Mehrere Feuerwehrschläuche lagen bereit. Die mussten nur noch ausgerollt und miteinander verkoppelt werden. Sie wirkten sehr beschädigt. Überall spritzte Wasser heraus, lauter kleine Fontänen. Beim Essen konnten wir zuschauen, wie es vor sich hin plätscherte.
Als jüngstes Crewmitglied hatte ich die Ehre, die Golden Harvest rüber zu fahren. Beim Anlegen sollte ich auf den Bugspriet achten. Roy erklärte mir kurz das Getriebe. Das ließ sich über selbst verlegte Seilzüge vom Ruderhaus mit einem Handrad umsteuern. Einen Maschinentelegrafen gab es nicht, keinen Indikator. Man konnte nicht erkennen, ob der Vorwärtsgang, der Rückwärtsgang oder Leerlauf eingestellt war. Roy meinte: »No problem!« Man könne das erfühlen.
Der Gashebel bestand aus einem Drahtseil, mit dem die Dieselzufuhr geregelt wurde. Das Ende hing neben dem Ruderrad an einem krummen Nagel. Ich testete erst mal den Wendekreis. Halbe Kraft voraus. Die Golden Harvest lag wundervoll in der Hand. Das Schiff reagierte auf die kleinste Bewegung des Ruderrades. Roy war stolz auf seine Lady.
Ich steuerte im weiten Bogen die Massengutpier an und drückte den Schoner mit dem Heck zuerst in die Fender des spanischen Fischerbootes. Wir warfen Achter- und Vorderspring, legten die Querleinen und machten fest. Roy stoppte Kati. Mein erstes Anlegemanöver hatte perfekt geklappt. Die Leute auf dem Trawler kannten mich noch. Cosinero winkte begeistert. Ich sollte ihm in die Kombüse folgen und helfen, einen großen Topf aus den Schlingerleisten zu heben. Das sei für die Freunde. »Para amigos!«
Die Suppe war noch warm. Dazu gab es ein paar Flaschen Rotwein. Die wurden gleich in den Kühltrog an Deck verbannt. Neben dem Ruderhaus am Backbord-Schanzkleid lehnte eine große unglasierte Amphore, gefüllt mit Süßwasser, das durch den porösen Ton sickerte und an der Außenseite Verdunstungskälte erzeugte. Ein afrikanischer Kühlschrank aus the Gambia. An der Pier stand ein togolesischer Mitarbeiter der Hafenmeisterei neben dem Hydranten. Mehrere Feuerwehrschläuche lagen bereit. Die mussten nur noch ausgerollt und miteinander verkoppelt werden. Sie wirkten sehr beschädigt. Überall spritzte Wasser heraus, lauter kleine Fontänen. Beim Essen konnten wir zuschauen, wie es vor sich hin plätscherte.

Gelegentlich paddelten Momo und Elise an Land, um etwas zu erledigen. Dann konnten wir »cocoa and weed parties« feiern und die Sau raus lassen, ohne dafür kritisiert zu werden. Mit cocoa war Kakao gemeint. Weed bedeutet Unkraut. Die cocoa and weed parties fanden an Deck statt, vorn, unter dem Sonnensegel, zwischen Fockmast und Niedergang. Dann lagen wir auf den Matratzen und taten all das, was Momo und Elise nicht gut fanden. Zum Beispiel Unsinn machen und fluchen. Wir sprachen ungestört von mother fucking bastards und grölten irische Lieder: »Under the old triangle when jingle jangle« Roy sang aus vollem Herzen. Das musste endlich mal gesagt werden: »For the sake of a bloody fuck!«
Es war wundervoll, stundenlang zwischen den Windhutzen an Deck zu sitzen, ohne überwacht zu werden. Wir rührten uns jeder einen Extralöffel von diesem kostbaren Milchpulver in den Kakao und rauchten das Gras so, wie wir es für richtig hielten. Auf den cocoa and weed parties wurde kaum über Operation Namibia gesprochen, wegen der vielen widersprüchliche Meinungen auch im Hinblick auf die Bevormundung Afrikas durch die westliche Welt. Wenn Momo und Elise an Bord waren, gab es permanent Diskussionen um diese Frage. Das politische Projekt vereinte uns nicht mehr. Momo fand es schlicht arrogant, dass die Weißen meinten, sie müssten ihr zivilisiertes Wissen nach Afrika tragen.
Das Einzige, was zumindest die Raucher an Bord zusammenhielt, war die Meinung zum afrikanischen Tabak. Unter Deck hing ein kleines Bild am Großmast, zwei Köpfe im Profil, die sich anblickten. Der linke Kopf hatte eine Tüte im Mund, der rechte eine Zigarette. Der linke Kopf war mit vielen schönen Konturen gefüllt, dem Wissen der Welt. Er strahlte. Der rechte wirkte dunkel, mit verkniffenem Blick. Ein Ornament zeigte die Lungen und dieses Gebilde formte das Wort »cancer«. Zwischen den beiden Köpfen stand das Wort »Competition«, Wettbewerb.
Es war wundervoll, stundenlang zwischen den Windhutzen an Deck zu sitzen, ohne überwacht zu werden. Wir rührten uns jeder einen Extralöffel von diesem kostbaren Milchpulver in den Kakao und rauchten das Gras so, wie wir es für richtig hielten. Auf den cocoa and weed parties wurde kaum über Operation Namibia gesprochen, wegen der vielen widersprüchliche Meinungen auch im Hinblick auf die Bevormundung Afrikas durch die westliche Welt. Wenn Momo und Elise an Bord waren, gab es permanent Diskussionen um diese Frage. Das politische Projekt vereinte uns nicht mehr. Momo fand es schlicht arrogant, dass die Weißen meinten, sie müssten ihr zivilisiertes Wissen nach Afrika tragen.
Das Einzige, was zumindest die Raucher an Bord zusammenhielt, war die Meinung zum afrikanischen Tabak. Unter Deck hing ein kleines Bild am Großmast, zwei Köpfe im Profil, die sich anblickten. Der linke Kopf hatte eine Tüte im Mund, der rechte eine Zigarette. Der linke Kopf war mit vielen schönen Konturen gefüllt, dem Wissen der Welt. Er strahlte. Der rechte wirkte dunkel, mit verkniffenem Blick. Ein Ornament zeigte die Lungen und dieses Gebilde formte das Wort »cancer«. Zwischen den beiden Köpfen stand das Wort »Competition«, Wettbewerb.
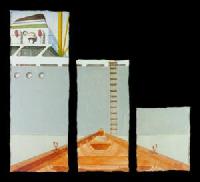
Die Golden Harvest war für das Geldverdienen tabu. Es durfte nicht sein. Das einzige Geld, das akzeptiert wurde, blieben freiwillige Spenden. Wir mussten uns etwas einfallen lassen. Ich dachte, es würde sicher leicht sein, die Seeleute auf den großen Schiffen bei irgendeiner Reparatur um Hilfe zu bitten, um ins Gespräch zu kommen. Es gab ein paar Arbeiten, die wir allein nicht erledigen konnten. Wir stellten eine Liste zusammen. Wenn ich danach fragte, ein paar Ösen geschweißt zu bekommen, zeigten sich die Leute hilfsbereit.
Die Rechnung ging auf. In den folgenden Tagen stand ich regelmäßig morgens nach dem Waschen mit dem Fernglas an Deck, um zu sehen, was im Hafen lag. Die großen Zeichen der Reedereien am Kamin konnte man mit bloßen Augen erkennen. Aus Deutschland kamen Woermann-Liner der Deutschen Afrika Linie. Sie blieben eine halbe Woche und fuhren dann nach Douala, oder zurück nach Hamburg.
Ich hatte inzwischen den Ehrgeiz entwickelt, die Golden Harvest wieder seeklar zu machen, damit keiner mehr sagen konnte, dass dies oder jenes fehlte. Das stand alles auf meiner Liste. So ging ich aufrecht an Bord. Stolz, wie ein Offizier. Es war angenehm. Bis auf das Paddeln durch den Hafen, gegen den Wind, mit diesem Meterstück vorne im Bug kniend unter der brennenden Sonne. Wir brauchten unbedingt neue Riemen.
Die Stückgutfrachter lagen an der Pier im Westen. Die Sonne kam aus Südosten. Ich musste die Schiffe von der Wasserseite anfahren. Die Hitze wurde von den Bordwänden reflektiert. Man konnte kaum atmen, beim Aufstieg über die Lotsenleiter. Die hing oft mittschiffs, sodass noch ein langer Weg über glühend heiße Decks zurückgelegt werden musste. Alles barfuß. Die Leute sahen, dass ich von dem Schoner kam. So landete ich regelmäßig in kürzester Zeit beim Kapitän des jeweiligen Schiffes, um mein Anliegen vorzutragen. Ich fragte nach Kleinigkeiten wie Schweißarbeiten oder speziellen Schrauben, die es in Afrika nicht zu kaufen gab. Sie halfen mit viel Sachverstand, hatten aber keine Riemen übrig, nur eine bestimmte Anzahl für die Rettungsboote. Häufig gab es Zigaretten und etwas zu essen.
Das Küchenpersonal interessierte sich am meisten für die Golden Harvest. Ob man da mal hin könnte und so. Manche wollten abends nach der Wache abgeholt werden, aber wenn sie dann das kleine Boot unter der dunklen Pier besteigen sollten, blieben sie lieber an Land. Das war denen zu finster. Dann hieß es, dass etwas dazwischen gekommen sei, und ich kurz warten sollte. Sie gaben mir Geschenke zum Trost. Wein, Whisky und Zigaretten. Die Suchtdrogen der Zivilisation. Ich kam nie mit leeren Händen zur Golden Harvest zurück.
Die Rechnung ging auf. In den folgenden Tagen stand ich regelmäßig morgens nach dem Waschen mit dem Fernglas an Deck, um zu sehen, was im Hafen lag. Die großen Zeichen der Reedereien am Kamin konnte man mit bloßen Augen erkennen. Aus Deutschland kamen Woermann-Liner der Deutschen Afrika Linie. Sie blieben eine halbe Woche und fuhren dann nach Douala, oder zurück nach Hamburg.
Ich hatte inzwischen den Ehrgeiz entwickelt, die Golden Harvest wieder seeklar zu machen, damit keiner mehr sagen konnte, dass dies oder jenes fehlte. Das stand alles auf meiner Liste. So ging ich aufrecht an Bord. Stolz, wie ein Offizier. Es war angenehm. Bis auf das Paddeln durch den Hafen, gegen den Wind, mit diesem Meterstück vorne im Bug kniend unter der brennenden Sonne. Wir brauchten unbedingt neue Riemen.
Die Stückgutfrachter lagen an der Pier im Westen. Die Sonne kam aus Südosten. Ich musste die Schiffe von der Wasserseite anfahren. Die Hitze wurde von den Bordwänden reflektiert. Man konnte kaum atmen, beim Aufstieg über die Lotsenleiter. Die hing oft mittschiffs, sodass noch ein langer Weg über glühend heiße Decks zurückgelegt werden musste. Alles barfuß. Die Leute sahen, dass ich von dem Schoner kam. So landete ich regelmäßig in kürzester Zeit beim Kapitän des jeweiligen Schiffes, um mein Anliegen vorzutragen. Ich fragte nach Kleinigkeiten wie Schweißarbeiten oder speziellen Schrauben, die es in Afrika nicht zu kaufen gab. Sie halfen mit viel Sachverstand, hatten aber keine Riemen übrig, nur eine bestimmte Anzahl für die Rettungsboote. Häufig gab es Zigaretten und etwas zu essen.
Das Küchenpersonal interessierte sich am meisten für die Golden Harvest. Ob man da mal hin könnte und so. Manche wollten abends nach der Wache abgeholt werden, aber wenn sie dann das kleine Boot unter der dunklen Pier besteigen sollten, blieben sie lieber an Land. Das war denen zu finster. Dann hieß es, dass etwas dazwischen gekommen sei, und ich kurz warten sollte. Sie gaben mir Geschenke zum Trost. Wein, Whisky und Zigaretten. Die Suchtdrogen der Zivilisation. Ich kam nie mit leeren Händen zur Golden Harvest zurück.

Die Kakerlaken hatten sich inzwischen weiter vermehrt. Sie wurden immer aufdringlicher, als wollten sie die Grenzen unserer Leidensfähigkeit ausloten. Manchmal, wenn die Crew nachts bei spärlichem Licht zusammensaß, kamen sie wie Kamikazeflieger angeflogen. Wir diskutierten tagelange, ob die cockroaches als »living beings« geachtet werden müssten, als Lebewesen, und welchen Grund die wohl haben könnten, dass sie mit uns zusammenwohnten. Jeder versuchte das Dasein dieser Monster zu rechtfertigen. Es war nicht leicht. Die Golden Harvest wog normalerweise 70 Tonnen, inklusive Ballast. In Lomé vermutete Roy, dass sie 71 wog. Siebzig Tonnen Schiff, plus eine Tonne Kakerlaken. Kris ermunterte die Katzen den Kerbtieren den Garaus zu machen, aber die wollten ihren Spaß, betäubten die Käfer nur ein wenig, damit sie sich weiter bewegten und mit den Beinen zappelten. Einmal sah ich, wie ein Kakerlak, den Grey Too zerbissen hatte, weidwund in zwei verschiedene Richtungen davonlief.
Momo meinte, die Viecher seien unsterblich. Wir versuchten, den Tieren mit Fallen beizukommen, »cockroach-traps«, stellten nachts Töpfe mit Wasser auf und tropften in jedes Gefäß etwas Palmnussöl, weil die Kakerlaken das mochten. Am Morgen waren sie gefüllt. Das brachte jedes Mal ein Pfund. Was ist das gegen eine Tonne? No Nonsense konnte nur die kleinen Käfer fressen, sodass wir uns schließlich dazu durchringen mussten, den Schoner auszugasen. Es gab mehrere Giftgasbomben an Bord, deutsches Biogiftgas, Zyklon B, aus Zuckerrübenmelasse. Die Gebinde sahen so ähnlich aus, wie Donnerschläge für das Silvester Feuerwerk. Anders als die Zyklon B Dosen in Auschwitz. Das waren viereckige Dinger, mit dicker Lunte und einer Reibefläche, wie bei einem Streichholz.
Auf der Golden Harvest wurde nun immer öfter von Krieg gesprochen. Vom Krieg gegen die Kakerlaken. Dem »war on cockroaches!« Es folgten endlose Diskussionen über das Lebensrecht aller Lebewesen, bis wir uns auf eine gewaltfreie Sprachregelung einigten. Aus dem Krieg wurde eine hygienische Maßnahme, ein »cockroach cleanup!« Eine Säuberung! Das klang weniger gewalttätig. Der Vorschlag kam von Elise. Alle waren einverstanden.
Die drei Bomben mussten jeweils in einem Kochtopf in der Bilge gezündet werden. Nach wenigen Minuten sprengte die Lunte die Versiegelung und setzte das Gift frei. Die Freunde wussten wie es funktioniert. Sie hatten das Schiff schon mal gereinigt. Erfolglos, obwohl sie in drei Schritten vorgegangen waren, im Abstand von mehreren Wochen, um auch die zu erwischen, die bei den ersten Attacken noch in den Eiern steckten. Die Eier blieben vom Gas unberührt. Sobald die nächste Generation schlüpfte, musste der zweite Angriff durchgeführt werden, und schließlich ein Dritter, um den Rest zu erwischen. Es gab zu viele Überlebende. In Ghana und Nigeria kam frisches Blut dazu.
Diesmal wollten wir richtig zuschlagen. Ein Overkill sollte stattfinden. An dem Abend, als gemeinsam der Massenmord beschlossen wurde, behandelten wir die Kakerlaken noch mal ganz besonders freundlich, fühlten uns wie Verräter. Kris hatte seinen Lieblingskäfern berühmte Namen gegeben: Cecil Rhodes, Adolf Hitler, Idi Amin. Die mussten jetzt alle dran glauben.
Momo meinte, die Viecher seien unsterblich. Wir versuchten, den Tieren mit Fallen beizukommen, »cockroach-traps«, stellten nachts Töpfe mit Wasser auf und tropften in jedes Gefäß etwas Palmnussöl, weil die Kakerlaken das mochten. Am Morgen waren sie gefüllt. Das brachte jedes Mal ein Pfund. Was ist das gegen eine Tonne? No Nonsense konnte nur die kleinen Käfer fressen, sodass wir uns schließlich dazu durchringen mussten, den Schoner auszugasen. Es gab mehrere Giftgasbomben an Bord, deutsches Biogiftgas, Zyklon B, aus Zuckerrübenmelasse. Die Gebinde sahen so ähnlich aus, wie Donnerschläge für das Silvester Feuerwerk. Anders als die Zyklon B Dosen in Auschwitz. Das waren viereckige Dinger, mit dicker Lunte und einer Reibefläche, wie bei einem Streichholz.
Auf der Golden Harvest wurde nun immer öfter von Krieg gesprochen. Vom Krieg gegen die Kakerlaken. Dem »war on cockroaches!« Es folgten endlose Diskussionen über das Lebensrecht aller Lebewesen, bis wir uns auf eine gewaltfreie Sprachregelung einigten. Aus dem Krieg wurde eine hygienische Maßnahme, ein »cockroach cleanup!« Eine Säuberung! Das klang weniger gewalttätig. Der Vorschlag kam von Elise. Alle waren einverstanden.
Die drei Bomben mussten jeweils in einem Kochtopf in der Bilge gezündet werden. Nach wenigen Minuten sprengte die Lunte die Versiegelung und setzte das Gift frei. Die Freunde wussten wie es funktioniert. Sie hatten das Schiff schon mal gereinigt. Erfolglos, obwohl sie in drei Schritten vorgegangen waren, im Abstand von mehreren Wochen, um auch die zu erwischen, die bei den ersten Attacken noch in den Eiern steckten. Die Eier blieben vom Gas unberührt. Sobald die nächste Generation schlüpfte, musste der zweite Angriff durchgeführt werden, und schließlich ein Dritter, um den Rest zu erwischen. Es gab zu viele Überlebende. In Ghana und Nigeria kam frisches Blut dazu.
Diesmal wollten wir richtig zuschlagen. Ein Overkill sollte stattfinden. An dem Abend, als gemeinsam der Massenmord beschlossen wurde, behandelten wir die Kakerlaken noch mal ganz besonders freundlich, fühlten uns wie Verräter. Kris hatte seinen Lieblingskäfern berühmte Namen gegeben: Cecil Rhodes, Adolf Hitler, Idi Amin. Die mussten jetzt alle dran glauben.